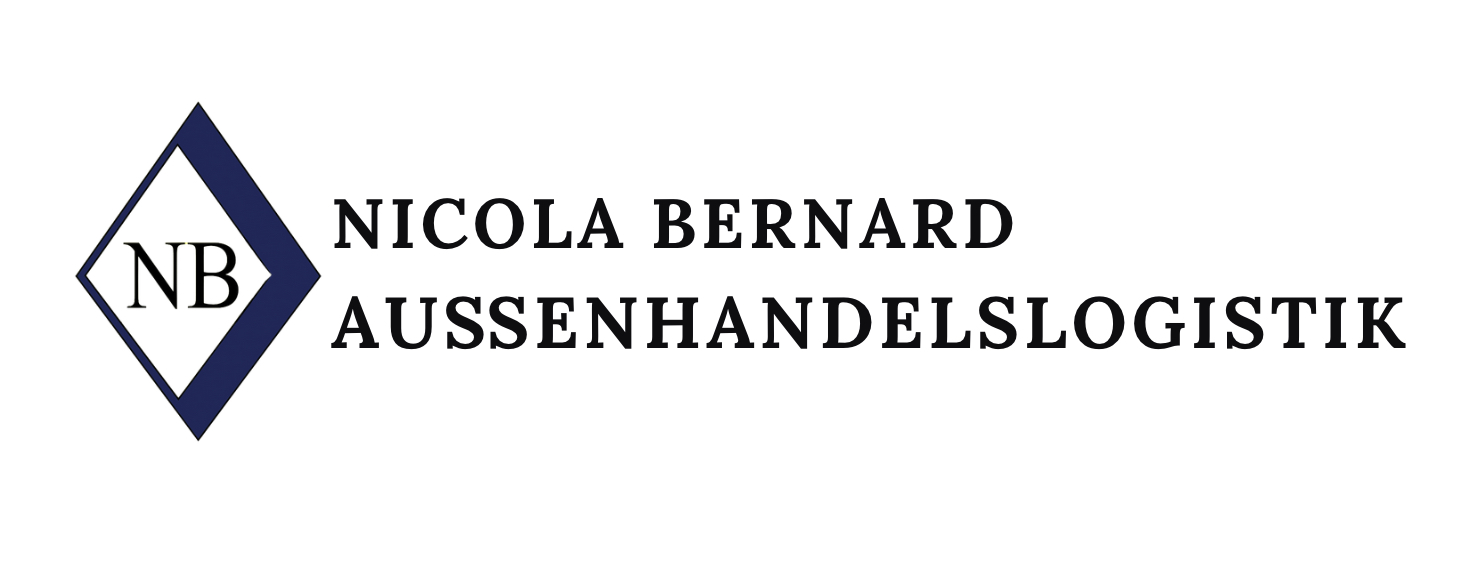Die Europäische Kommission hat zwei Berichte vorgestellt, die den Weg für eine europaweite Strategie zur dauerhaften Entfernung von Kohlendioxid ebnen könnten. Neben einem Überblick über den Stand der hierfür eingesetzten Technologien wird auch ein Modell für ein gemeinsames Beschaffungsprogramm diskutiert.
Das Ziel: die permanente CO₂-Entfernung
Unter (CDR) versteht die EU jede Maßnahme, die Kohlenstoff für Jahrhunderte oder länger speichert – sei es in geologischen Formationen, im Boden, im Ozean oder in langlebigen Produkten. Im Gegensatz zu kurzfristigen Senken wie Aufforstung gelten diese Verfahren als unverzichtbar, um unvermeidbare Restemissionen auszugleichen. Das Ziel: Bis 2050 sollen jährlich mindestens 114 Millionen Tonnen CO₂ dauerhaft entfernt werden – aktuell liegt die weltweite Kapazität jedoch erst bei rund 0,125 Millionen Tonnen.
Marktübersicht: Technologien und Kosten
Der Bericht „Carbon Removals in the EU“ führt über 300 laufende CDR-Projekte auf. Besonders weit entwickelt ist die Nutzung von Biochar, die mit einem Technologiereifegrad zwischen 6 und 9 bewertet wird. Dagegen befinden sich Verfahren wie Direktluftabscheidung (DACCS) oder Mineralisierung noch in der Pilotphase (Reifegrad 4–6). Auch die Kostenunterschiede sind erheblich: Während Biochar aktuell zwischen 80 und 250 Euro pro Tonne CO₂ liegt, bewegen sich die Preise für DACCS bei 450 bis 1.250 Euro pro Tonne. Laut einer Analyse von McKinsey könnte das Marktvolumen für CO₂-Entfernung in Europa bis Mitte des Jahrhunderts auf bis zu 1,1 Billionen Euro anwachsen. Deutschland, Schweden und die Niederlande gehören zu den Vorreitern bei der Projektentwicklung. Hemmnisse bestehen vor allem bei den hohen Kapitalkosten, der begrenzten Verfügbarkeit von Biomasse, fehlender Speicherinfrastruktur und unzureichenden Finanzierungsmöglichkeiten.
Vorschläge für ein EU-weites Beschaffungsprogramm
Um Unternehmen Investitionssicherheit zu geben, skizziert der zweite Bericht „an EU Purchasing Programme for Permanent Carbon Removals“ verschiedene Optionen. Besonders hervorgehoben wird ein möglicher EU Removals Fund, der gezielt CO₂-Entfernung einkauft, unterschiedliche Technologien unterstützt und privates Kapital mobilisiert. Zudem wurden eine zentrale Beschaffungsagentur und ein gemeinsamer Buyers’ Club vorgeschlagen. Auf längere Sicht werden auch komplexere Strukturen wie eine Carbon Central Bank oder ein Investitionsvehikel innerhalb der Europäischen Investitionsbank in Betracht gezogen – diese sind jedoch mit hohen Anlaufkosten verbunden.
Politische Realisierbarkeit und Verbindung zum ETS
Als besonders praktikabel gilt der EU Removals Fund, da er im Vergleich zu aufwendigeren Konzepten schneller umzusetzen wäre. Anders als der Innovationsfonds, der in erster Linie die Entwicklung neuer Technologien finanziert, soll dieses Instrument gezielt Nachfrage erzeugen, Standards definieren und Marktbedingungen gestalten. Die Studien weisen hierbei auch auf die Option einer strategischen Verknüpfung mit dem EU-Emissionshandel (ETS) hin. Langfristig könnten Zertifikate für die CO₂-Entfernung in den ETS integriert werden, wodurch die private Nachfrage gestärkt und die Maßnahmen schrittweise in die Klimapolitik eingebettet werden würden. Ein Beschaffungsprogramm bliebe dabei dennoch notwendig, um Netto-Negativ-Emissionen zu erreichen.
Finanzierungsbedarf bis 2030
Für das Zwischenziel von fünf Millionen Tonnen dauerhaft entzogenem CO₂ bis 2030 werden Investitionen zwischen 2,4 und 6,7 Milliarden Euro erwartet. Die Finanzierung soll aus verschiedenen Quellen stammen, darunter EU-Haushaltsmittel, Beiträge der Mitgliedstaaten sowie private Gelder. Vorgesehen sind unterschiedliche Instrumente, etwa Auktionen, Vorabkaufvereinbarungen oder langfristige Abnahmeverträge, um das erforderliche Kapital zu sichern.
Quelle: DIHK